Hi, so wie ich heute gehört habe,gibt die BRD Regierung 32 Millarden Euro für Inflationsausgleich aus ?
Die Summe ergibt sich da hierfür keine Steuern anfallen !!
1. Wer hat denn den bekommen ?
2. Wer hat Anspruch darauf ?
3.Was ist mit allen anderen ?
Soweit ich mich informiern konnte, bekommen Regierung, alle Abgeordneten,Beamte,Öffentlicher Dienst,
Pensionäre und Öffentlich rechtliches Fernsehen diese Zuwendung als Einzelpersonen
Was bei größeren Firmen geschiet und welche Firma was ausgezahlt hat ?
Ob das, dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes entspricht, ich glaube nicht !
Hier bedient sich der Staat und seine Angestellten auf Kosten der Steuerzahler.
Inflationsprämie für Beamte des Bundes: Gesetzgebung läuft
Inflationsprämie für Beamte des Bundes: Gesetzgebung läuft
Damit das Tarifergebnis für Beamte und Pensionäre des Bundes umgesetzt werden kann, ist ein Gesetzentwurf nun in erster Lesung im Bundestag verhandelt worden. Die Mühlen der Demokratie mahlen langsam. Bis zum Beschluss des Gesetzes wird es noch einige Wochen dauern. Daher hat der Bund Abschlagszahlungen angewiesen. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte auf Anfrage mit: „Solange ein Gesetz noch nicht im Bundesgesetzblatt verkündet ist, können Abschlagszahlungen geleistet werden. Diese Zahlungen (hier: Abschläge auf die Sonderzahlungen) können aber naturgemäß erst erfolgen, wenn die technischen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Umfangreiche Softwareänderungen sind bzw. waren dafür erforderlich und zu testen. Die meisten Beamten und Beamtinnen im aktiven Dienst sollten die Sonderzahlungen für die Monate Juni 2023 bis einschl. Oktober 2023 inzwischen bereits erhalten haben.“
Damit ist klar, dass für die Mehrheit der Pensionäre und Versorgungsempfänger noch kein Geld überwiesen wurde. Das Ministerium teilte mit, wie viel sie erwarten können. Im Gesetzentwurf wird die Höhe der Zahlung beschrieben.
So wird die Sonderzahlungen den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern des Bundes anteilig, d.h. unter Berücksichtigung der jeweiligen Ruhegehalts- und Anteilssätze des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages gewährt werden, wie dies auch schon in der Vergangenheit bei Einmalzahlungen praktiziert wurde.
„In Übertragung des TV Inflationsausgleich vom 22. April 2023 erhalten Empfänger von Dienstbezügen und von Leistungen nach dem Wehrsoldgesetz für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleich 2023) in Höhe von 1 240 Euro sowie für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro“, heißt es auf der Webseite des Bundesinnenministeriums. „Empfängern von Versorgungsbezügen werden die jeweiligen Beträge in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts- und Anteilssatzes gewährt, wie dies auch bei in der Vergangenheit gewährten Einmalzahlungen an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern der Fall war.“
Das Punktesystem der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt das während des Berufslebens erzielte Durchschnittseinkommen, während sich das Ruhegehalt berechnet nach den Dienstbezügen des letzten Amts, soweit ruhegehaltfähig. Übersteigt das Gehalt eines rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmers die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung von 7100 Euro monatlich (alte Bundesländer, Stand 2021) bzw. 8700 Euro in der knappschaftlichen Rentenversicherung, wirkt dies nicht rentensteigernd, weil für den übersteigenden Betrag keine Beiträge zu entrichten sind. Jedoch kann sich der Mehrverdienst auf eine Betriebsversorgung auswirken. Der insoweit nicht zu entrichtende Arbeitnehmerbeitrag kann vorsorgewirksam angelegt werden. Das Endgrundgehalt (Stufe 8), aus dem sich im Regelfall das Ruhegehalt errechnet, beginnt bei Beamten des höheren Dienstes im Bundesdienst ab Besoldungsgruppe A 15 (Amtsbezeichnung Regierungsdirektor) mit 7123,18 Euro die niedrigere Beitragsbemessungsgrenze zu übersteigen (Stand 2021).
- Der Ruhegehaltsempfänger erhält nach Erreichen der Altersgrenze bis zu 71,75 Prozent multipliziert mit 0,9901, also 71,04 Prozent, seiner letzten Bezüge als Ruhegehalt (bezogen auf das Bruttogehalt). Dieser volle Anspruch wird nach 40 Dienstjahren erreicht, bei einem Ruhestand vor erreichter Regelaltersgrenze aber dauerhaft gekürzt. Das Ruhegehalt wird nach der ruhegehaltfähigen Dienstzeit (§ 6 BeamtVG) und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 5 BeamtVG) berechnet. Die Absenkung des Höchstversorgungssatzes von ursprünglich 75 Prozent auf 71,75 Prozent wurde vom Bundesverfassungsgericht als „noch“ verfassungsgemäß angesehen. Aus juristischer Sicht könnte somit „eine weitere Absenkung der Versorgungsbezüge … vom BVerfG als unzulässig verworfen werden[11].“ (S. 114).
- Die Altersrente ist von Beitragshöhe und Beitragszeit abhängig. Sie bemisst sich nach erbrachten Rentenbeiträgen, die – außer bei Geringverdienenden – zu je 50 Prozent vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber erbracht werden müssen. Beim monatlichen Durchschnittsgehalt eines Angestellten von 3304 Euro[12] ergibt sich nach Rentenformel ein Rentenanspruch von 35 Euro pro Jahr. Die Altersrente des „Eckrentners“ beträgt durchschnittlich 48 Prozent des letzten Bruttoeinkommens. Die Altersrenten sinken voraussichtlich auf bis zu 40 Prozent. Der Nachhaltigkeitsfaktor beeinflusst die jährliche Rentenanpassung entsprechend der Veränderung des Verhältnisses der Beitragszahler zu den Rentenbeziehern. Die gesetzliche Grundlage des Rentenniveaus vor Steuern – offiziell „Sicherungsniveau vor Steuern“ findet sich in § 154 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 SGB VI.
- Ruhegehaltsempfänger haben Anspruch auf eine Mindestversorgung, die aus dem Alimentationsprinzip folgt. Berechnungsgrundlage der Mindestversorgung sind 65 Prozent der letzten Stufe der Besoldungsgruppe A 4. Altersrenten sind von den erbrachten Rentenbeiträgen (Entgeltpunkte/Rentenformel) abhängig und prinzipiell nach unten nicht begrenzt, ggf. können aber andere staatliche Leistungen wie Grundsicherung, Wohngeld oder ergänzende Sozialhilfe bezogen werden – genau dies soll Ruhegehaltsempfängern erspart bleiben, damit sie auch zu aktiven Zeiten ihr Amt unabhängig führen können.
- Ruhegehaltsempfänger erhalten von ihrem Dienstherrn zwischen 50 Prozent und 70 Prozent (von Familienstand und Kindern abhängig) ihrer Krankheits- und Pflegekosten als Beihilfe erstattet, allerdings sind – analog zur gesetzlichen Krankenversicherung – nicht alle Aufwendungen beihilfefähig. Zwar unterlagen Besoldungsempfänger (und damit auch Ruhegehaltsempfänger) bis zum 1. Januar 2009 nicht der Pflicht zur Versicherung, wenn sie aber das letztlich kaum kalkulierbare Risiko des restlichen Kostenanteils nicht selber tragen wollten, mussten sie für den Rest eine private Kranken- und Pflegeversicherung abschließen. Aufgrund der Beitragsstruktur solcher Versicherungen, die von vielen verschiedenen Faktoren (Eintrittsalter, Zahl der Versicherten etc.) sowie vom Leistungsumfang abhängt, sind die Beiträge sehr unterschiedlich und können, da es keine beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten und Kindern gibt und der Beitrag sich nicht am individuellen Einkommen orientiert, von etwa 3 Prozent bis zu rund 25 Prozent des Ruhegehaltes betragen. Allerdings ist es ihnen auch möglich, sich im Basistarif versichern zu lassen. Im Basistarif gilt in der Regel der Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (wegen des Beihilfeanspruchs nur ein anteiliger Prozentsatz davon). Ebenso besteht für Besoldungsempfänger, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, die Möglichkeit der Beibehaltung der Mitgliedschaft, sie müssen dann aber auch selbst für den Arbeitgeberanteil aufkommen, sodass sich diese Wahl in der Regel nicht lohnt; ein aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschiedener Besoldungsempfänger darf dort in der Regel nicht wieder Mitglied werden. Im Gegensatz dazu zahlen gesetzlich krankenversicherte Altersrentner einheitlich den halben Beitragssatz zur Krankenversicherung (14,6 Prozent : 2 = 7,3 Prozent) und den halben Zusatzbeitrag der betreffenden Krankenkasse (2020: durchschnittlich 1,1 Prozent : 2 = 0,55 Prozent). Ehepartner und ggf. Kinder sind beitragsfrei mitversichert, sofern sie keine eigenen sozialversicherungspflichtiges Einkünfte beziehen. Außerdem zahlen die Rentner die volle Pflegeversicherung (2020: 3,05 Prozent der Rente und ggf. 0,25 Prozent Zusatzbeitrag bei Kinderlosigkeit).
- Ruhegehaltsempfänger zahlen Einkommensteuer auf das gesamte Ruhegehalt abzüglich des Versorgungsfreibetrages, Renten unterlagen bis Ende 2004 der Einkommensteuer nur mit dem Ertragsanteil, welcher vom Renteneintrittsalter und -jahr abhing. Im Jahr 2005 unterlagen Altersrenten zu 50 Prozent Bemessungsgrundlage, der Einkommensteuer. Bis 2020 erhöht sich die Bemessungsgrundlage in 2 Prozent-Schritten auf 80 Prozent, bis 2040 in 1-Prozent-Schritten auf 100 Prozent (Alterseinkünftegesetz). Aufgrund des steuerlichen Grundfreibetrags werden ledige Eckrentner aber davon erst im Jahre 2011 (West) bzw. 2013 (Ost) betroffen, sofern dieser Betrag von rund 639 Euro (2008) bis dahin nicht noch erhöht wird.
- Ein Teil der Ruhegehaltsempfänger erhält (je nach Dienstherrn) einmal jährlich eine Sonderzahlung (Weihnachtsgeld), teilweise wird die Sonderzahlung auch monatlich gewährt. Dieser Anspruch wurde in den vergangenen Jahren mehrfach gekürzt bzw. ist teilweise ganz entfallen. Rentner erhalten für im aktiven Berufsleben verdientes Weihnachtsgeld oder sonstige Zusatzleistungen wie Urlaubsgeld nur dann eine entsprechende Erhöhung ihrer Monatsrente, wenn diese Leistungen rentenversicherungspflichtig (d. h. Einkommen inklusive Weihnachtsgeld unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze) waren und somit bei der Rentenberechnung berücksichtigt worden sind. Kürzungen bei Weihnachts- und Urlaubsgeld von im Berufsleben stehenden Arbeitnehmern wirken sich auf bereits verrentete Arbeitnehmer nicht mehr aus, während bei Ruhegehaltsempfängern Verschlechterungen von Besoldungsbezügen fast immer umgesetzt werden.
- Betriebsrenten werden bei einer Vielzahl von größeren Unternehmen und für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst bezahlt. Insgesamt erhalten 16 Prozent aller Arbeitnehmer eine solche Zusatzrente von im Schnitt 325 Euro (2002), während Ruhegehaltsempfänger solche Leistungen nicht beziehen bzw. eine Anrechnung wie bei gesetzlichen Renten erfolgt (siehe nächster Punkt).
- Ruhegehaltsempfänger, die früher als Angestellte oder Arbeiter Rentenanwartschaften erworben haben, erhalten zusätzlich zur Pension eine Rente. Diese Rente wird jedoch gemäß § 55 BeamtVG ganz oder teilweise mindernd auf die Pension angerechnet, das heißt das Ruhegehalt wird gekürzt (und zwar am Monatsanfang für die erst am Monatsende gezahlte Rente). Ebenfalls weitgehend angerechnet werden Hinterbliebenenrenten.
- Ruhegehaltsempfänger mit Ehepartner bzw. Kindergeldberechtigung wird aufgrund des Alimentationsprinzips der entsprechende Anteil des familienbezogenen Teil des Bruttoeinkommens als Teil des Ruhegehalts solange bezahlt, wie Ehe oder Kindergeldberechtigung besteht.
Ruhegehälter und Sozialversicherungsrenten sind nur schwer vergleichbar; ein einfacher Vergleich oben genannter Prozentzahlen erlaubt keinen Rückschluss auf die tatsächliche Versorgungshöhe einer Einzelperson.
Vergleich zwischen Haushaltseinkommen von Ruhegehaltsempfängern und Rentnern
Eine 2013 durchgeführte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes ermittelte ein Haushaltsnettoeinkommen bei Rentnerhaushalten in Höhe von 2206 Euro gegenüber einem Haushaltsnettoeinkommen eines Ruhegehaltsempfängers in Höhe von 4404 Euro.[13] Im Jahr 2017 galten 19,5 Prozent aller Personen aus Rentnerhaushalten als armutsgefährdet, jedoch nur 0,9 Prozent aus Haushalten von Ruhegehaltsempfängern[14].
Für den Ruhestand der Arbeitnehmerhaushalte ermittelt das Statistische Bundesamt einen Einkommensrückgang nach OECD-Skala von 44 Prozent und 13 Prozent für den eines Empfängers von Ruhegehalt.
Nachhaltige Finanzierung der Versorgung
Besoldungsempfänger zahlen nicht direkt Beiträge für die Altersvorsorge. Vielmehr gilt: „Die … geringeren Grundgehälter der Beamten gegenüber den Grundvergütungen der Arbeitnehmer werden .. als Beitragsleistung der Beamten für ihre Versorgung angesehen“.[15] Ähnlich auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom März 2002.[16]
Für die öffentlichen Haushalte stellen die Ruhegehälter eine beachtliche Belastung dar. Wie Bernd Raffelhüschen u. a. in einer Studie 2005 berechnete, betragen die Barwerte der Ruhegehaltslasten der Länder 1797 Milliarden Euro[17] und sind damit größer als die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte. In verschiedenen Bundesländern werden Anstrengungen unternommen durch Einrichtung von Versorgungsfonds vergleichbar mit dem Versorgungsfonds des Bundes für neu eingestellte Besoldungsempfänger die Versorgungsausgaben zu sichern. Eine Entlastung der Haushalte ist allerdings erst zu erwarten, wenn die neu eingestellten Besoldungsempfänger in den Ruhestand gehen. Die Versorgungs-Steuerquote wird von 2001 (ca. 10 Prozent) in vielen Bundesländern auf über 20 Prozent im Jahre 2020 steigen, im Stadtstaat Hamburg wird sogar jeder vierte Euro der Einnahmen zur Finanzierung der Ruhegehälter ausgegeben werden. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Hansestadt seit etwa Anfang der achtziger Jahre nicht mehr in die Beamtenpensionskasse eingezahlt und somit keine Rücklagen gebildet hat. Die Ruhegehälter müssen deshalb über Kredite finanziert werden.
Rheinland-Pfalz hatte 1996 einen Pensionsfonds eingerichtet, der zukünftige Ruhegehalts- und Beihilfeleistungen abdecken sollte. Zwischen 27,7 Prozent und 38,8 Prozent der Besoldungsausgaben für neu eingestellte Besoldungsempfänger wurden zusätzlich einem kapitalgedeckten Fonds zugeführt, für ältere neu eingestellte Besoldungsempfänger erhöhte sich der Prozentsatz ab 45 bzw. 50 Jahren um 50 Prozent bzw. 100 Prozent. Bis 2004 sollten die zukünftigen Ausgaben von 20 Prozent der Landesbeamten durch den Pensionsfonds abgedeckt werden. Aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz wurde der Pensionsfonds Rheinland-Pfalz 2017 aufgelöst und die Rücklagen als Sondervermögen fortgeführt.[18]
Einzelnachweise
- Versorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes 2021 (Fachserie 14 Reihe 6.1). (PDF) In: destatis.de. 20. Dezember 2021, abgerufen am 27. Juli 2022.
- BVerfG, Beschluss vom 20. März 2007, Az. 2 BvL 11/04, Volltext
- BVerfG, Urteil vom 27. September 2005, Az. 2 BvR 1387/02, Volltext.
- BT-Drs. 17/6359: Ehebezogene Regelungen sollen auf Lebenspartnerschaften übertragen werden.
- LSVD: Stand der rechtlichen Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten. (Memento vom 20. März 2011 im Internet Archive)
- Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Beamtenversorgung in Deutschland seit 1990, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, 1. April 2016
- Einkommensstruktur von Rentner- und Pensionärshaushalten Bundeszentrale für politische Bildung vom 16. November 2016, abgerufen am 2. August 2019
- Rentner stärker von Altersarmut betroffen als gedacht Süddeutsche Zeitung vom 21. Februar 2019, abgerufen am 2. August 2019
- Beamte oder Arbeitnehmer Schriftenreihe der Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung Band 6, Kapitel 4.2.3, Köln 1996, abgerufen am 15. August 2019
- Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 6. März 2002 – 2 BvL 17/99 – Tz 183, abgerufen am 15. August 2019
- Die Pensionslasten der Bundesländer im Vergleich: Status Quo und zukünftige Entwicklung (PDF; 618 kB)
-
Ahnen: „Konsequente Neuordnung bei Pensionsfonds und PLP“. In: fm.rlp.de. 14. Juni 2017, abgerufen am 4. Februar 2022.

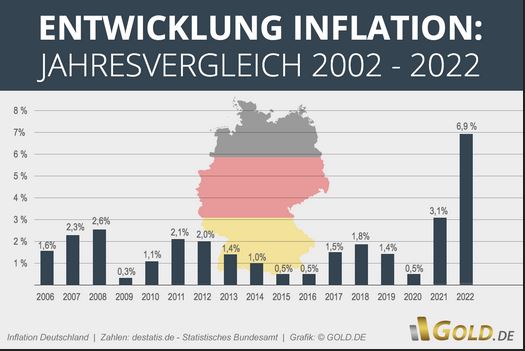
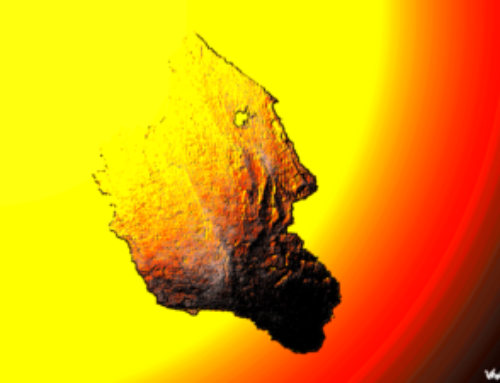

Hinterlasse einen Kommentar